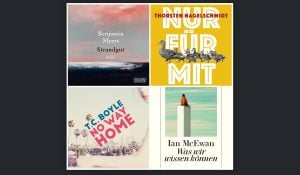Neue Bücher von Seishi Yokomizo, Volker Weidermann, Lionel Richie, Yishai Sarid und Gaea Schoeters
Gaea Schoeters – Das Geschenk (Zsolnay)
Eine Satire, eine Parabel, ein politischer Kommentar, auf alle Fälle ein ganz großer, kleiner Roman. Beziehungsweise ein scharfsinniges, humorvolles und exzellent geschriebenes schmales Buch (144 Seiten), das einen nach der Lektüre noch länger beschäftigt und das man gerne gleich nochmal in die Hand nimmt. Der Plot, den sich die Autorin nach einer Zeitungsmeldung über Botswana im Bordbistro der Deutschen Bahn ausdachte (man kann sich bereits gut ein „Making-of“ vorstellen), ist realistisch anmutende Satire, die praktisch elefantöse (sic!) Ausmaße annimmt: Nachdem die deutsche Regierung ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen, im Speziellen auch Elfenbein, beschlossen und damit den armen Regionen Botswanas die Lebensgrundlage entzogen hatte, schickte der dortige Präsident 20.000 Elefanten als „Geschenk“ nach Deutschland. Wie genau, ist eher unwichtig, aber da sind sie plötzlich: baden in der Spree, tröten vor dem Kanzleramt, schlagen Schneisen durch Parks und Grünanlagen und verursachen gar Auffahrunfälle beim Queren von Autobahnen. Der fiktiven Bundesregierung (Bezüge zu realen Personen nicht ausgeschlossen) bei der Lösung des „Elefanten-Problems“ zu folgen, gehört zum Klügsten und Komischsten, was dieses Jahr zulesen war. Dass der fiktive amtierende Regierungschef deutlich sympathischer als der reelle ist und seine Frau zum hocherotischen Schäferstündchen ins Kanzleramt einlädt, ist nur eines von vielen schönen Details. Gaea Schoeters hat nach dem lesenswerten Vorgänger „Trophäe“ erneut bewiesen, dass sie zu den ganz großen Autorinnen ihrer Generation gehört. Must read. (Lesung am 4. Dezember im Literaturhaus)
Rainer Germann
Yishai Sarid – Chamäleon (Kein & Aber)
Der große Teufel heißt Eitelkeit. Und die Droge, die er verkauft, ist die Sichtbarkeit und das Euphorie-Rauschen in den sozialen Netzwerken. Shai Tamus, Kulturkritiker einer renommierten Zeitung in Israel, hat lange genug ausgewogen berichtet, brav die jeweils gegensätzlichen Standpunkte gegeneinander abgewogen und dann richtigen Schlüsse gezogen sowie Kompromisse angedeutet. Resultat: Man schätzt ihn, doch seine Artikel wandern immer weiter nach hinten ins Blatt. Eines Tages wird sogar sein Gehalt gekürzt. Dann entdeckt er das Dope: Mit Zuspitzungen, krasseren Thesen, dem bewussten Verzerren lassen sich viel höhere Wellen schlagen. Und dann wird Shai auch wieder in Fernseh-Talkshows eingeladen. Es ist die alte Geschichte des Faust-Paktes, die Yishai Sarid für die Generation Instagram aktualisiert. Nur dass es sehr reales, sehr böses Spiel wird, von dem er erzählt: Shai Tamus erkauft sich seinen Ruhm durch einen Deal mit der erzkonservativen, reaktionären Regierung, an deren Spitze ein sehr klar erkennbarer israelischer Ministerpräsident steht, der im Roman seine Macht sichert, in dem er liberales Denken diffamiert und unterdrückt. Shai wird zum Sprachrohr der Rechten – mit einem Einflüsterer-Mephisto, der ihm ganz genau sagt, was der Staatschef in den Medien lesen und hören möchte. Natürlich kann das nicht gut gehen. Mit bitterem Ernst!
Rupert Sommer
Volker Weidermann – Wenn ich eine Wolke wäre (KiWi)
Wer denkt da nicht an ein kleines Wunder, wenn ein Lyrikband die Bestsellerlisten stürmt und das 23 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung. Februar 1956 erscheint in Hamburg die Neuausgabe des „Lyrischen Stenogrammhefts“ und mit ihm aus New York die von den Nazis verfemte deutsch-jüdische Dichterin Mascha Kaléko. Erstmals seit ihrer Flucht in letzter Minute 1938 macht sie sich auf die Reise nach Deutschland, um ihr Buch zu promoten und natürlich ihren Sehnsuchtsort Berlin wiederzusehen. Ihre Heimat, wo Mascha zur gefeierten Literatin wurde und ihre große Liebe Chemjo fand. Aber wird sie willkommen sein im Land der Täter? Kein leichter Balanceakt, die ungeheuerlichen Verbrechen zu benennen und doch ihre eigene Zugehörigkeit zur deutschen Kultur zu behaupten. Von einem schicksalhaften Jahr zwischen märchenhaftem Comeback, Annäherung und neuerlicher Entfremdung erzählt Volker Weidermanns einfühlsames Porträt „Wenn ich eine Wolke wäre“. Aus der Sicht seiner charmanten ‚Heldin‘, ihrer täglichen Briefe und schönsten Zeitgedichte begegnen wir wichtigen Verlegern und Kritikern, Exilanten und gebliebenen Autoren, erleben den Luxus des Wirtschaftswunder-Schlaraffenlands ebenso wie die kargen Neuanfänge jüdischen Lebens in der geteilten Stadt. Spätestens, als Mascha hier ihre verschollene Schwester in die Arme schließen kann, sind auch wir bereit für ihr Überlebens-„Rezept“: „Zerreiß deine Pläne. Sei klug. Und halte dich an Wunder“.
Eveline Petraschka
Lionel Richie – Truly (Reclam)
Halleluja, 125 Millionen verkaufte Alben, vier Grammy Awards und ein Oscar. Lionel Richie legt mit 76 Jahren seine 512-seitigen Memoiren vor. Als schüchterner Junge mit ADHS wächst er in Tuskegee, Alabama zu Zeiten der Rassentrennung auf, „The Commodores“ reifen mit ihm zu Funk-Helden und als Schmusesänger wird er zum Brückenbauer zwischen Soul, Pop und Rhythm & Blues. Während Richie mit Michael Jackson am Song „We Are the World“ feilt, taucht eine Schlange hinter den Regalen des Musikzimmers auf. Produzent Quincy Jones nennt Jackson „Smelly”, weil er oft vergisst, seine Kleider zu wechseln. An anderen Stellen umarmt Richie Nelson Mandela oder wird von Frank Sinatra ge- ohrfeigt. Langatmig sind die Passagen über zwei gescheiterte Ehen und mancher Klatsch und Tratsch aus Hollywood; bewegend ist, wie offen Richie Trauer, Depressionen und Schuldgefühle thematisiert. Nach einer Stimmbandblutung bangt er um seine Stimme, nach dem Tod von Oma, Mutter und Vater stürzt er ab, leert in Jamaika täglich eine Flasche Champagner. Mit 50 Jahren das Comeback: Von Luciano Pavarotti wird er für ein Benefizkonzert engagiert, verliebt sich neu, spielt vor 200.000 Menschen auf dem Glastonbury Festival und wird Juror bei „American Idol“. Mit Charme und Chuzpe nimmt Richie die Musikbranche aufs Korn und freut sich, wenn Pärchen zu seinen Songs Sex haben, frei nach dem Motto: Easy like Sunday Morning.
Wolfgang Scheidt
Seishi Yokomizo – Der Inugami-Fluch (Blumenbar)
Eine wunderbare Neu- und Wiederentdeckung ist dem Blumenbar Verlag mit den Honkaku-Krimis des japanischen Autors Seishi Yokomizo (1902-1981) gelungen. In seiner Heimat ein Literatur-Star, allein seine Reihe um den Privatdetektiv Kosuke Kindaichi umfasst 77 Bände, den man in eine Reihe mit Autor*innen wie Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie und Georges Simenon stellen muss. Meisterhaft verknüpft Yokomizo in seiner feinsinnigen Sprache die japanische Kultur mit klassischen „Whodunit“-Plots. Im vorliegenden, bereits vierten auf Deutsch er schienenen und von Ursula Gräfe übersetzten Band wird Kindaichi in die Villa eines kürzlich verstorbenen schwerreichen Seidenfabrikanten in einen abgelegenen Teil Japans gerufen. Dessen Anwalt fürchtet, dass das Testament einen erbitterten Kampf zwischen den untereinander verfeindeten Erben auslösen wird und fürwahr, kaum ist das komplizierte und mit einem gehörigen Hass auf die Nachgeborenen verfasste Dokument verlesen, rollen wortwörtlich die Köpfe … Intrigen, verbotene Liebschaften, uneheliche Kinder – Kindaichi muss die dunklen Geheimnisse des Clans ergründen, um den perfiden Mörder zu finden. Sein Großvater bezog stets einen Aspekt der japanischen Geschichte oder Kultur mit ein, um seinen Geschichten eine besondere Atmosphäre zu verleihen, sagt Yokomizos Enkel On Nomoto im Interview. Wie gesagt, eine Ent- deckung.
Rainer Germann